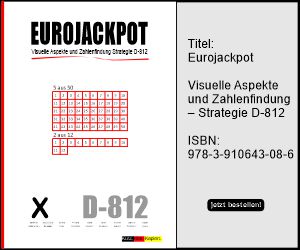Es gibt Gefühle, die laut sind, die mit der Tür ins Herz fallen, die alles durchschütteln, als wären wir bloß Häuser aus Pappe. Und es gibt Gefühle, die still sind, zugleich aber auch tief. Sie sind tiefer als wir selbst. Das Gefühl Wut gehört dabei zu beiden Kategorien. Denn mal tobt sie wie ein Sturm, dann aber sitzt sie mal ganz still in einer Ecke der Seele und kaut auf unseren Gedanken herum. Und doch ist sie kein Gast, den wir gerne bei uns behalten. Denn Wut wächst, und dabei ist sie wie Unkraut zwischen unseren Erinnerungen. Wenn wir sie nicht rechtzeitig erkennen, reißt sie schließlich alles mit sich, nämlich unsere Gelassenheit, unsere Beziehungen und vor allem unseren inneren Frieden.
Interessant ist, dass kaum ein Gefühl so häufig missverstanden wird, wie die Wut. Dabei hat sie natürlich ein Recht darauf, da zu sein. Schließlich ist die Wut nicht das eigentliche Problem, sie ist nur ein Signal. Ein Signal, das uns zeigt, dass etwas nicht stimmt. Ein Zeichen dafür, dass wir erkennen sollen, dass unsere Grenzen überschritten wurden und insbesondere dass unser Bedürfnis nach Gerechtigkeit, Nähe oder Verständnis verletzt wurde. Doch statt diesem zuzuhören, sperren viele sie weg und vergessen dabei, dass eingesperrte Gefühle nicht verschwinden. Sie verwandeln sich einfach nur in Bitterkeit, in Groll oder in Zynismus und manchmal sogar in Krankheit.
Wissenschaftlich betrachtet ist Wut eng mit unserem Nervensystem verknüpft. Sie aktiviert den Sympathikus, den Teil unseres autonomen Nervensystems, der auf Kampf oder Flucht vorbereitet. Unser Puls steigt, unsere Muskeln spannen sich an, Stresshormone fluten den Körper. Kurz gesagt bedeutet das, dass der Körper in Alarmbereitschaft geht. Was aber früher dem Überleben diente, lässt uns heute bei Alltagskonflikten explodieren, in der Partnerschaft, am Arbeitsplatz oder zum Beispiel im Straßenverkehr. Oft reagieren wir nicht nur über, weil der Anlass so groß ist, sondern weil unsere inneren Archive übergeladen bzw. überfrachtet sind. Denn dort lagern längst vergessene Kränkungen wie staubige Kartons in der hintersten Ecke. Kaum fällt also ein falscher Satz, und schon fällt uns alles wieder vor die Füße.
Aber genau hier kommt etwas ins Spiel, das oft zu früh oder zu spät zur Sprache kommt, und zwar das Vergeben. Das darf aber nicht verwechselt werden mit dem Verdrängen. Vergebung ist letztlich kein Zuckerguss über eine bittere Wahrheit. Sie ist eine bewusste Entscheidung. Das bewusste Vergeben ist also kein einmaliger Akt, sondern ein Prozess. Manchmal dauert dieser Prozess mehrere Wochen, manchmal sogar Jahre und manchmal geschieht er leise, zum Beispiel an einem Nachmittag, wenn man auf der Couch sitzt und sich eingesteht, dass man sich selbst zu lange mit einer Schuld gequält hat, die einem gar nicht gehört.
Vergebung heißt also nicht: „Es war okay.“ Es heißt vielmehr: „Ich lasse es los. Nicht, weil du es verdient hast – sondern weil ich Frieden verdient habe.“
Wer vergibt, öffnet dabei ein Fenster in sich selbst, so dass in einen frische Luft herein kommt. Es kommen damit einher auch neue Gedanken, neue Möglichkeiten und vor allem aber eine neue Version von sich selbst. Eine, die nicht mehr auf das Alte reagiert, sondern für das Neue lebt.
Man erkennt es bei Menschen, die gelernt haben zu vergeben. Denn sie strahlen anders, nicht unbedingt glücklicher, aber entschieden freier. Es ist, als hätten sie den Schlüssel zu einer Tür gefunden, die wir alle irgendwann brauchen. Und sie haben etwas begriffen, das so einfach und doch so schwer ist. Wut ist kein Zeichen von Stärke. Sie ist ein Schmerz, der sich verkleidet hat. Wer vergibt, nimmt ihm das Kostüm ab und erkennt darin oft das eigene verletzte Ich.
Im Alltag zeigt sich das ganz unscheinbar. Die Kollegin, die wieder einmal den Erfolg für sich beansprucht hat, der Partner, der in einer Diskussion einen Ton getroffen hat, der bis ins Mark ging, die Mutter, die nie gesagt hat, dass sie stolz ist. Es sind vielleicht nur Kleinigkeiten, aber wer kennt sie nicht? Und wer hat sie nicht schon mit sich herumgetragen wie kleine, unsichtbare Felsbrocken im Rucksack des Lebens?
Doch manchmal reicht ein Gespräch, manchmal ein innerer Monolog und manchmal einfach die Erkenntnis, dass der andere es nicht besser konnte. Oder dass wir selbst auch nicht immer besser waren. Wir wissen schließlich alle, dass Menschlichkeit zugleich auch Verfehlbarkeit bedeutet. Aber genau darin liegt auch ihr Zauber, denn sie erlaubt uns, nicht perfekt zu sein, aber dennoch wachsam zu bleiben und bereit zu sein, loszulassen, was uns zurückhält.
Wut hat selbstverständlich auch ihren Platz in uns, aber nur nicht auf Dauer. Sie darf uns zeigen, wo es weh tut. Doch sie darf nicht entscheiden, wer wir werden. Das ist und bleibt unsere Wahl. Und vielleicht ist das größte Geschenk, das wir uns selbst machen können, kein teures Erlebnis, kein neuer Besitz, sondern ein innerer Satz: „Ich lasse los. Für mich.“
Denn Vergebung ist nicht nur eine Tür nach draußen – sie ist auch der Weg zurück zu uns.